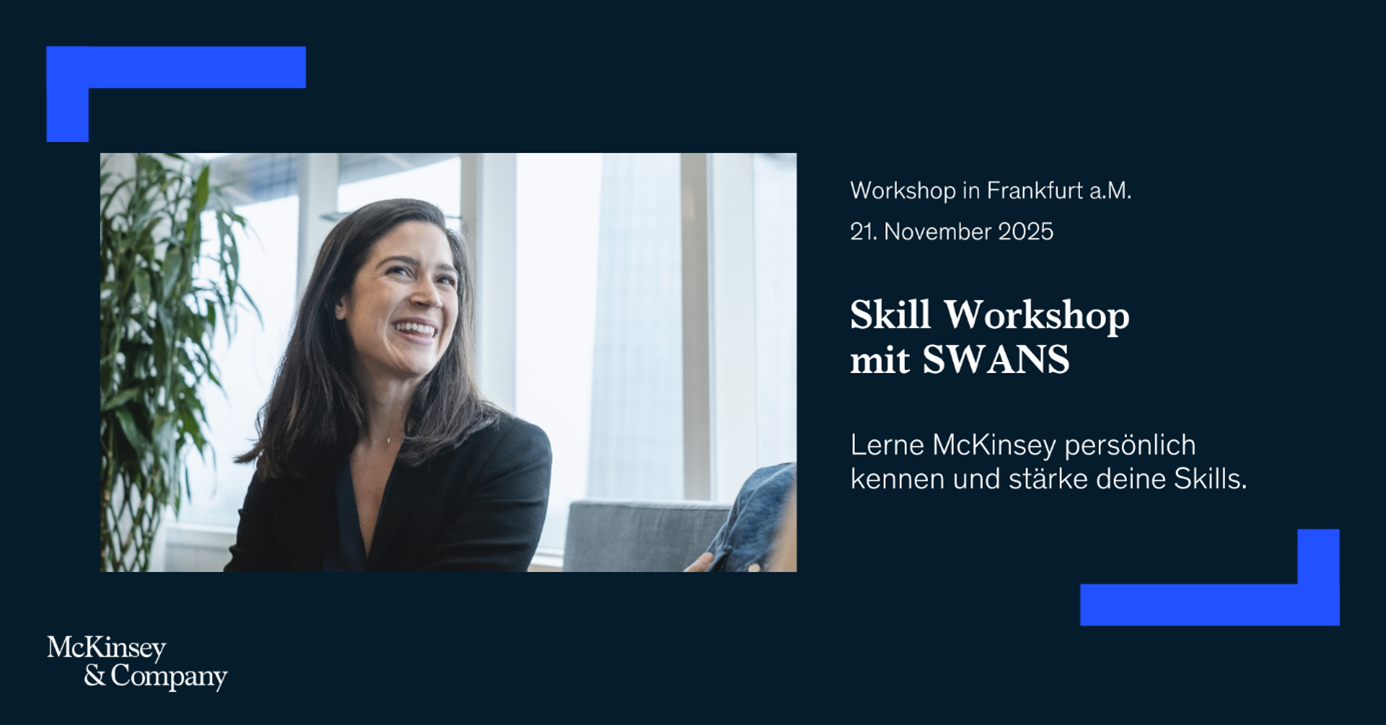Prof. Dr. Marylyn M. Addo ist seit 2017 W3-Professorin für Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), wo sie die Abteilung für Infektionskrankheiten leitet und Gründungsdirektorin des Instituts für Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung ist. Ihr Forschungsgebiet sind insbesondere Virusimmunologie und Impfstoffstrategien gegen neu auftretende Viruserkrankungen. Dazu gehören klinische Studien mit neuartigen Impfstoffkandidaten gegen Viren wie MERS (Middle East Respiratory Syndrome) und Ebola. Seit 2013 ist sie am UKE tätig. Ihre medizinische Ausbildung als Internistin und Infektiologin verlief von Bonn über Frankreich, die Schweiz und London bis nach Boston (Harvard Medical School). Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo ist 1970 in Bonn geboren und hat zwei Kinder. Dieses Interview führte Zekiye Tolu
SWANS: „Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Wie sind Sie aufgewachsen?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Ich bin als Tochter eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter zusammen mit meinem Bruder in einer Kleinstadt im Rheinland aufgewachsen. Ich würde meine Kindheit und Jugend als behütet und glücklich bezeichnen. Zunächst war ich zwei Jahre in einem englischen Kindergarten und einer Preschool, danach wechselte ich ins deutsche Schulsystem und machte dort mein Abitur.
Schon früh begann ich mit Ballett, interessierte mich für Kunstturnen und Voltigieren und spielte Querflöte. Ich engagierte mich in der katholischen Jugendarbeit und sang in einem Jugendchor.
Die Ferien verbrachte ich oft sehr naturverbunden auf dem Bauernhof meines Großvaters in der Eifel: Kühe auf die Weide bringen, melken, Traktor fahren, bei der Ernte helfen – viel Aktion mit elf Cousinen und Cousins. Später betreute ich Jugendfreizeiten und Zeltlager.“
SWANS: „Gab es Vorbilder, die Sie früh geprägt haben und einen positiven Einfluss auf Sie hatten?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „In meiner Kindheit wurde ich vor allem von meinen Eltern als Vorbilder geprägt. Mein Vater war ein kluger Mann – eher zurückhaltend, aber sehr warmherzig. In seiner Tätigkeit als Arzt hat er viele Menschen auch jenseits des Medizinischen berührt – das hat mich stets beeindruckt und auch ein wenig stolz gemacht.
Sein Weg aus einer kleinen Stadt in Ghana, ohne akademischen Hintergrund und mit begrenzten finanziellen Ressourcen, über gute schulische Leistungen und Stipendien bis hin zum Medizinstudium in Deutschland, hat mich immer inspiriert. Aus diesem Lebensweg heraus entstand auch sein oft zitierter Satz: „Was du weißt, kann dir keiner nehmen.“ In diesem Zusammenhang verwies er oft auf Nelson Mandela, dessen Persönlichkeit in unserer Familie sehr präsent war – insbesondere als Vorbild für Resilienz und Integrität.
Meine Mutter stammte aus einem kleinen Dorf in der Eifel, ging mit 15 Jahren für eine Ausbildung nach Bonn und wurde früh selbstständig. Für beide Elternteile war ihre „mixed-race“-Beziehung in ihren Herkunftsfamilien eigentlich ein No-Go. Sie haben diese Verbindung trotz anfänglichem Widerstand und rassistischen Anfeindungen mit großem Mut, viel Liebe und beeindruckender Stärke gelebt.
Ich bin meinen Eltern sehr dankbar für ihre Unterstützung und dafür, dass sie meine Neugier und Entdeckungslust stets gefördert haben – auch wenn die finanziellen Möglichkeiten oft begrenzt waren. In manchen Familien mit Migrationshintergrund in meinem Umfeld wurde viel Druck auf die Kinder ausgeübt, etwa nach dem Motto: „Ihr müsst immer besser sein als die anderen.“ Das war bei uns nie ein Thema. Bildung, Lernen und Lesen wurden wertgeschätzt und gefördert – aber um der Sache willen, nicht aus Leistungsdruck.
In meiner späteren beruflichen Laufbahn wurde ich von wunderbaren Mentorinnen und Mentoren begleitet – unter anderem von Prof. Bruce Walker und Prof. Jürgen Rockstroh. Auch Michelle Obamas Zitat: „When they go low, we go high“ begleitet mich bis heute in vielen Situationen.“
SWANS: „Was hat Sie dazu bewegt zu studieren und warum haben Sie sich für die medizinische Richtung entschieden?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Ich war schon immer wissbegierig, habe mit Begeisterung gelesen und gerne Neues gelernt. Der medizinische Beruf faszinierte mich früh, weil er so facettenreich ist: Von der Patientenbetreuung in Klinik oder Praxis über Wirtschaft und Industrie bis hin zu Beratung, Lehre und Forschung eröffnen sich viele spannende Wege.
Nach dem Abitur habe ich ganz bewusst und sehr intensiv auch andere Studiengänge in Betracht gezogen – kurz standen Chemie, Lebensmittelchemie, Philosophie und Theologie im Raum –, weil es mir fast zu ‘klischeehaft’ erschien, als Tochter eines Arztes ebenfalls Medizin zu studieren. Letztlich entschied ich mich dann doch für die Medizin – und habe es nie bereut.
Dass ich heute in der Forschung und als Professorin tätig bin, hatte ich zu Beginn meines Studiums weder geplant noch auch nur in Erwägung gezogen. Ursprünglich wollte ich Kinderärztin werden – auch motiviert durch meine langjährige Jugendarbeit in Sport und Gemeinde (als Trainerin, bei Zeltlagern, Ferienfreizeiten und als Camp Counselor in den USA).
Später interessierte ich mich für Gynäkologie und Geburtshilfe – bis mich schließlich die Begeisterung und Leidenschaft für die Infektiologie gepackt hat und nicht mehr losließ. Die (eigentlich sehr lustige) Geschichte dazu sprengt hier den Rahmen, aber ich erzähle sie gern, um zu zeigen: Viele Menschen in Leitungspositionen haben keine geradlinigen Lebensläufe. Oft sind sie bunt, vielfältig – und manchmal auch überraschend.
Deshalb ermutige ich meine Mentees und Mitarbeiter:innen ausdrücklich dazu, ihren eigenen Weg zu finden. Dieser darf auch mal eine Schleife drehen oder vorübergehend in einer Sackgasse enden. Dann braucht es manchmal Mut zur Umorientierung und die Bereitschaft, sich neu auszurichten.“
SWANS: „Wie fühlten Sie sich in den USA im Vergleich zu Deutschland? Haben Sie in eines der Länder Rassismus erfahren? Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „In den USA habe ich im sehr liberalen und internationalen Boston im Bundesstaat Massachusetts gelebt. Ich habe mich dort mit meiner Familie in einem vielfältigen und internationalen Umfeld sehr wohlgefühlt und tatsächlich kaum oder nur wenig Rassismus erlebt. Fast im Gegenteil – in den Institutionen, in denen ich gearbeitet habe, gab es zahlreiche Förderprogramme, Stipendien und Netzwerke für Diversity, Equity und ‚underrepresented minorities‘, von denen auch ich profitieren durfte. Das ist sicherlich nicht überall in den USA der Fall.
In Deutschland jedoch habe ich – wie wahrscheinlich fast jede*r BIPOC – im Laufe meines Lebens immer wieder Rassismus und Diskriminierung erfahren: manchmal subtil, manchmal aggressiv, manchmal aus Ignoranz oder Unbedachtheit. Von verbalen Anfeindungen über das Angespucktwerden bis hin zu Hundekot auf unserer Familiengarage war leider alles dabei.
Als schwarze Frau im ärztlichen Beruf passte man häufig nicht in das klassische Bild. Als junge Assistenzärztin wurde ich beispielsweise gefragt, ob ich „auch einmal Krankenschwester werden möchte“. Und selbst heute muss ich auf der Krankenhausvisite gelegentlich reizenden älteren Damen, die fragen, wann denn der ‚Herr Professor‘ komme, erklären: ‚ICH bin die Frau Professor‘ – weil das leider noch immer nicht den gängigen Stereotypen entspricht.
Während der COVID-19-Pandemie war ich als schwarze Frau in der Öffentlichkeit relativ präsent – und die Anfeindungen bekamen dadurch eine neue Dimension: unter anderem in Form von xenophoben E-Mails und Social-Media-Posts. In dieser Zeit hat mir meine Institution sehr den Rücken gestärkt, etwa durch Rechtsbeistand und -beratung.
Wie gehe ich mit solchen Situationen generell um? Ich bin sehr dankbar für meine ghanaisch-deutschen Wurzeln und meine mixed heritage, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Aus diesem Selbstverständnis heraus versuche ich, mit Diskriminierung und Rassismus umzugehen. Die jeweils angemessene Reaktion hängt dabei von der individuellen Situation ab.
Manchmal eignet sich Humor gut – zum Beispiel, wenn man dem klassischen ‚Sie sprechen aber gut Deutsch!‘ mit einem schmunzelnden ‚Danke, Sie aber auch!‘ begegnet. Aber andere Situationen erfordern einen ernsteren Umgang und eine klare Positionierung.“
SWANS: „Wie kann ich mir den Alltag als Direktorin vorstellen? Was sind mögliche Herausforderungen und wie bewältigen Sie diese?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Ich bin ‘Clinician Scientist’, das heißt, ich bin sowohl klinisch als auch forschend tätig. Diese Kombination bereitet mir große Freude und prägt auch meine wissenschaftliche Arbeit maßgeblich.
Meine derzeitige Position umfasst drei Hauptfacetten, die sich gut im Motto des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) widerspiegeln: „Wissen – Forschen – Heilen“.
Als Direktorin meines Instituts für Infektionsforschung beschäftige ich mich vor allem mit immunologischer Virusforschung und der Entwicklung von Impfstoffen. Ich arbeite mit Medizinstudierenden, naturwissenschaftlichen Doktorand:innen, Postdocs und anderen ‘Clinician Scientists’ an spannenden wissenschaftlichen Fragestellungen. Gemeinsam planen wir Experimente, analysieren Daten, verfassen Forschungsanträge und wissenschaftliche Publikationen.
Ein weiterer Teil meiner Tätigkeit ist die Leitung der klinischen Sektion Infektiologie an der I. Medizinischen Klinik des UKE. Hier arbeite ich mit Ärzt:innen in Weiterbildung, Fachärzt:innen und Oberärzt:innen in der Patient:innenversorgung zusammen. Dazu gehören unter anderem ein Konsildienst, interdisziplinäre Boards, ein Antimicrobial Stewardship Team – und natürlich gehe ich sehr gerne auf Visite.
Die dritte Facette meines Berufs ist die Lehre – sowohl für Medizinstudierende als auch im postgraduierten Bereich, zum Beispiel im Tropenkurs des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. Auch das macht mir viel Freude.
Wie in jedem Beruf gibt es auch bei mir Herausforderungen. Ich vermisse manchmal die Zeit für kreative, tiefgehende Arbeit, weil bürokratische und administrative Aufgaben einen großen Teil meiner Kapazitäten beanspruchen. Die Vielzahl an Online-Meetings und die (zu) vielen Deadlines sind ebenfalls fordernd. Zeitmanagement und Priorisierung sind daher für mich ein ständiger Lernprozess.
Mir ist es wichtig, neben dem Beruf auch Raum für Partnerschaft, Familie und Freundschaften zu haben. Zum Stressausgleich meditiere ich regelmäßig und versuche, Sport, Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf in meinen Alltag zu integrieren – wobei da definitiv noch Luft nach oben ist. Ich spiele und lese gerne und verbringe bewusst Zeit mit meinen Liebsten – das gibt mir die nötige Kraft, um meinen oft anspruchsvollen Alltag gut zu meistern.“
SWANS: „Wie kamen Sie dazu in den USA zu arbeiten und dann wieder nach Deutschland zurückzukehren?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Tatsächlich war mein Weg nicht von langer Hand geplant. Ich hatte ursprünglich eher im französischsprachigen Raum studiert – in Straßburg (Frankreich) und Lausanne (Schweiz) im Rahmen des Erasmus-Programms – und absolvierte später einen Masterstudiengang sowie den Diplomkurs in Tropenmedizin in London.
Diese Auslandsaufenthalte haben mich sehr geprägt, meinen Horizont erweitert und mir neue Perspektiven eröffnet – auch auf den ärztlichen Beruf. Studienaufenthalte im Ausland würde ich daher auch heute noch allen Studierenden, unabhängig vom Fach, sehr ans Herz legen. In der Universitätsmedizin werden internationale Forschungsaufenthalte durchaus gefördert und unterstützt.
Mein Mann und ich haben uns beide auf Stipendien von DFG und DAAD beworben und konnten so gemeinsam ans Massachusetts General Hospital in Boston gehen, eines der Lehrkrankenhäuser der Harvard Medical School. Der Aufenthalt war zunächst auf zwei bis drei Jahre angelegt – letztlich wurden daraus 14 wunderbare Jahre (1999–2013), in denen auch unsere beiden Kinder geboren wurden.
Auch unsere Rückkehr nach Deutschland war nicht geplant, sondern das Ergebnis eines Zusammenspiels aus glücklichen Umständen und dem Mut, mit der Familie noch einmal neu aufzubrechen. In Boston waren wir eigentlich sehr zufrieden: Ich hatte meine Fachärztinnenausbildung in Infektiologie abgeschlossen, war als Infectious Diseases Attending am Massachusetts General Hospital tätig, Assistant Professor an der Harvard Medical School und leitete eine kleine Forschungsgruppe am Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard. Mein Mann war in seinem Forschungslabor sehr erfolgreich, und unsere Kinder fühlten sich im Kindergarten und an der Deutschen Schule in Boston wohl.
Wir suchten also nicht aktiv nach neuen Herausforderungen – bis uns ein ehemaliger Postdoc-Kollege aus Hamburg auf eine freiwerdende Professur aufmerksam machte. Wir waren stets deutschlandverbunden, und nach zwei erfolgreichen Berufungsverfahren ergaben sich tatsächlich Professurangebote für uns beide. Dass sich diese Gelegenheit gleichzeitig in einer großartigen Stadt wie Hamburg und in einem attraktiven wissenschaftlichen Umfeld ergab, war ein besonderer Glücksfall. So entschieden wir uns, die Zelte in Boston abzubrechen und uns auf das neue Abenteuer Hamburg einzulassen.“
SWANS: „Auf welche wissenschaftlichen Forschungen und Errungenschaften sind Sie aus ihrer Arbeit besonders stolz?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Mich fasziniert es immer wieder, wenn Menschen und Teams in Extremsituationen gemeinsam Außergewöhnliches erreichen. Für mich sind das die schönsten und bedeutungsvollsten Errungenschaften.
Gerade in meinem Forschungsbereich ist echter Fortschritt fast immer das Ergebnis von Teamarbeit. Ein prägendes Beispiel war der große westafrikanische Ebola-Ausbruch von 2013 bis 2016 und die Behandlung des ersten Ebola-Patienten in Deutschland am UKE. Wir haben ihn mit großem Einsatz im interdisziplinären Team betreut und konnten dabei wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erkrankung und ihrer Behandlung gewinnen – was auch dem Patienten selbst, der aus dem medizinischen Bereich stammte, ein zentrales Anliegen war (DOI: 10.1056/NEJMc1500455).
Ein weiterer besonderer Moment war unsere Ebola-Impfstoffstudie, die gemeinsam mit den Ergebnissen internationaler Partner dazu beigetragen hat, dass 2019 der weltweit erste Ebola-Impfstoff zugelassen wurde – ein bedeutender Durchbruch bei einer Erkrankung mit Sterblichkeitsraten von bis zu 30–90 % (DOI: 10.1056/NEJMoa1502924). Zu sehen, wie dadurch inzwischen viele Todesfälle verhindert werden konnten, war ein echtes Privileg.
Diese Arbeit führen wir heute fort – in einem interdisziplinären, internationalen Team im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1648 ‘Emerging Viruses: Pathogenesis, Structure, Immunity’, der im Oktober 2024 gestartet ist. Ich freue mich sehr, diesen Forschungsverbund als Sprecherin leiten zu dürfen.“
SWANS: „Welche Inhalte Ihrer Arbeit möchten Sie jungen Student:innen besonders ans Herz legen?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: “Ich arbeite sehr gerne wissenschaftlich und begeistere mich immer wieder für die Forschung und das damit verbundene ‘lifelong learning’. Für mich fühlt sich Forschung oft an wie die ersten Schritte auf unberührtem Schnee – ein echtes Hochgefühl.
Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit am IIRVD ist die Entwicklung von Impfstoffen. Im Kontext der COVID-19-Pandemie kam es zu erheblichen Verunsicherungen rund um das Thema Impfen, und die Impfquoten für Standardimpfungen sind in Deutschland inzwischen suboptimal. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen zu betonen: Impfstoffe gehören zu den wirksamsten und kosteneffizientesten medizinischen Technologien, die je entwickelt wurden.
Abgesehen von sauberem Wasser hat keine andere Gesundheitsintervention einen größeren Einfluss auf die globale Gesundheit und die Reduktion der Sterblichkeit gehabt – insbesondere bei Kindern (Plotkin’s Vaccines, 8. Auflage, 2023). Impfungen tragen außerdem wesentlich zur Erreichung von 14 der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) bei. Als eine der wirkungsvollsten globalen Gesundheitsmaßnahmen spiegeln sie das Ethos der SDGs wider: „leaving no one behind“ (GAVI, 2023).
Impfungen sind in gewisser Weise Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden: In Deutschland sehen wir im Alltag kaum noch Menschen mit Lähmungen durch Poliomyelitis (Kinderlähmung) – dadurch wird die Notwendigkeit von Impfungen oft nicht mehr als akut wahrgenommen. Doch Impfungen sind ein kostbares Gut, das gerade in unserer heutigen Zeit besonders geschützt, gefördert und vermittelt werden muss.”
SWANS: „Wie sieht die Chancengleichheit von Frauen in der Medizin aus?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Trotz des hohen Frauenanteils im Medizinstudium spiegelt sich diese Präsenz nicht in den Führungspositionen wider. Je höher die Karrierestufe, desto seltener sind Frauen vertreten. Die Gründe dafür sind vielfältig: strukturelle Hürden, unbewusste Vorurteile und nicht zuletzt die nach wie vor schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gerade in der Phase der Familiengründung verlieren wir viel weibliches Talent. Es fehlen oft auch sichtbare ‘Role Models’, die zeigen, dass eine Führungsposition mit Familie möglich ist. Für mich persönlich war das ein entscheidender Faktor: Es gab viele Momente in meiner Karriere mit zwei kleinen Kindern, in denen ich kurz davor war, alles hinzuwerfen – manchmal zweimal die Woche.
Was mir geholfen hat, waren mein Netzwerk anderer ‘Working Moms’ und Kolleginnen, die auf ihrem Weg schon weiter waren. Sie haben mir Mut gemacht, dranzubleiben, und mir gezeigt, dass Krisen und Zweifel dazugehören – aber auch überwindbar sind.
Um echte Chancengleichheit zu erreichen, braucht es gezielte Förderung, transparente Auswahlprozesse und vor allem einen Kulturwandel – in der Gesellschaft, in der Klinik und in der Forschung. Frauen müssen zudem aktiver in berufliche Netzwerke investieren – aber hier bewegt sich bereits viel.
Ich selbst bin zum Beispiel Mitglied bei Infectnet, einem Verband, der deutsche Infektionsforscherinnen vernetzt und nachhaltig sichtbar machen möchte.
Einblicke in interessante und vielfältige Lebensläufe von Professorinnen am UKE finden sich hier.“
SWANS: „Welche Rolle wird die Künstliche Intelligenz in der Medizinbranche spielen? Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin und wie kann ich mich als Student:in darauf vorbereiten?“
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Künstliche Intelligenz (KI) wird die Medizin grundlegend verändern – und tut das bereits: in der Diagnostik, bei Therapieentscheidungen, in der Forschung und zunehmend auch in der Arzt-Patient:innen-Kommunikation. Wie bei vielen neuen Technologien birgt das große Chancen: KI kann präzisere Diagnosen unterstützen, personalisierte Behandlungen ermöglichen und Ärzt:innen mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben verschaffen.
Gleichzeitig stellen sich zentrale Fragen und Risiken, die kritisch beleuchtet werden müssen: Wer programmiert die Systeme? An welchen Daten wird die KI trainiert?
Wer trägt Verantwortung für Fehler? Wie verhindern wir, dass bestehende Bias und Ungleichheiten digital fortgeschrieben werden? Wie gehen wir mit ethischen Fragestellungen um?
Gerade für Medizinstudierende lohnt es sich, offen und neugierig zu bleiben. Es ist sinnvoll, sich technologische Grundkenntnisse anzueignen – etwa durch das Lernen einer Programmiersprache –, interdisziplinär zu denken und sich aktiv mit ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten neuer Technologien auseinanderzusetzen.
Die Medizin der Zukunft braucht Ärzt:innen, die nicht nur mit Daten, sondern auch mit Menschen und Verantwortung umgehen können.
Ich sehe den menschlichen und zwischenmenschlichen Aspekt des ärztlichen Berufs weiterhin als zentral und unverzichtbar – und bislang nicht ernsthaft gefährdet.
Aber: ‘Time will tell’.“
SWANS: „Welchen Ratschlag würden Sie unseren ‘Schwänen’ abschließend mitgeben?”
Prof. Dr. med. Marylyn M. Addo: „Für mich war das Zitat ‘Life begins at the end of your comfort zone’ oft ein wertvoller Impuls und Ratgeber: Es hat mich ermutigt, mich herauszufordern, Neues zu wagen und mich auch auf Ungeplantes einzulassen.
Liebe Schwäne, findet etwas, das euch begeistert und eure Neugier weckt. Verfolgt mutig den Weg, den ihr gehen möchtet – und bleibt euch und euren Werten treu. Bringt euch ein, stellt Fragen, nehmt Raum ein – auch wenn es manchmal unbequem ist.
Sucht euch Netzwerke und Mentor:innen, die euch in verletzlichen Phasen Stabilität und Unterstützung geben können.
Mich persönlich begleiten bis heute die ‘3 A’s of Awesome’ aus dem gleichnamigen TED-Talk bzw. Buch von Neil Pasricha:
- Attitude (Einstellung): Eine positive Grundhaltung – selbst in schwierigen Zeiten. Es geht um Resilienz und darum, das Gute im Leben zu erkennen.
- Awareness (Achtsamkeit): Den Moment bewusst wahrnehmen und die kleinen Freuden des Alltags wertschätzen.
- Authenticity (Authentizität): Sich selbst treu bleiben, zu sich stehen – und nicht leben, um es anderen recht zu machen.
Auch ich bin dabei noch auf meinem Weg. 😊“
SWANS: „Vielen Dank für das Gespräch!“